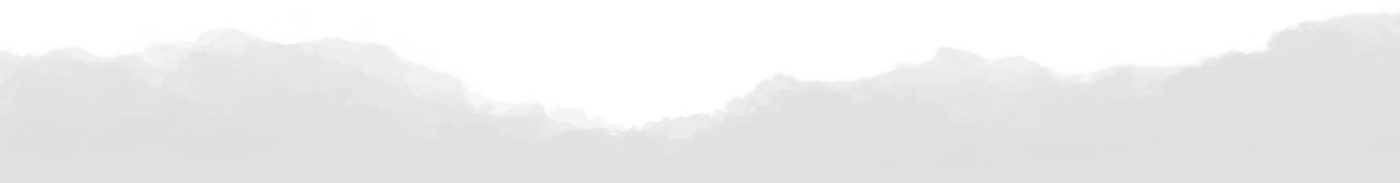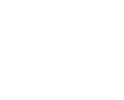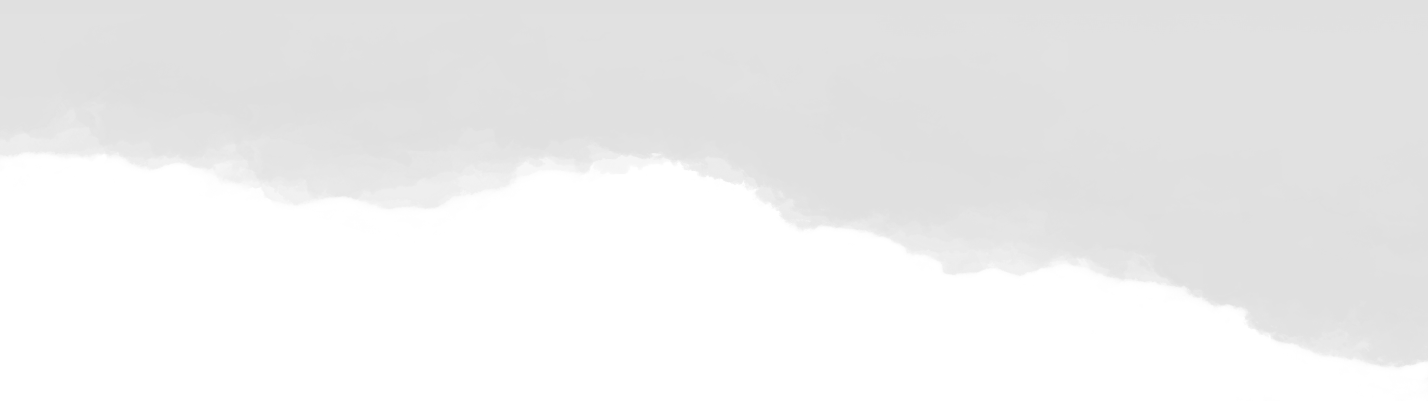Reisereportage von Sarah Emminger
„Bahhnsteig 5 – Zug fährt ein!“, schallt es aus den Bahnhofslautsprechern. Gut, wir sind rechtzeitig da. Es gab den Tag über noch so viel zu erledigen. Fertig packen, einen Corona-Test machen, Uni-Vorlesungen, Zoom-Meetings - das alles hielt uns heute beschäftigt. An einem anderen Mittwoch hätten sich solche Erledigungen jedoch bestimmt mühsamer angefühlt, als an diesem. Denn ich bin schon gestern mit einem vorfreudigen Lächeln eingeschlafen und heute morgen damit aufgewacht. Es ist Juni im Jahr 2021. Endlich wieder reisen. Endlich wieder durch eine fremde Stadt spazieren und einen neuen Ort entdecken.
Mein Freund und ich steigen in den Zug ein. Noch sind viele Leute unterwegs, es ist ja auch erst halb acht abends. In unserem reservierten Abteil sitzt außer uns noch eine weitere Person. Ein junger Mann, der stirnrunzelnd auf sein Handy schaut. Nach ein paar Haltestationen steigen noch mehr Menschen ein. Eine Frau setzt sich uns gegenüber. In einem Tragegurt hat sie ein Baby auf sich sitzen. Die beiden haben die gleichen, strahlend blauen Augen. Das Kind scheint müde zu sein, es quengelt ein wenig. Noch erschöpfter sieht aber seine Mutter aus. Sie hat mehrere Einkaufstüten mit und kramt mit der rechten Hand ein paar Minuten lang nach etwas, bevor sie entnervt und mit einem lauten Seufzer aufgibt. Mit der linken Hand krault sie die ganze Zeit den Kopf ihres Babys, um es zu beruhigen. Noch jemand möchte zu uns ins Abteil. Ein kleiner, zotteliger Hund riecht wohl unsere mitgebrachte Jause. Seine Besitzerin beobachtet ihn zwar gerade nicht und ist in ihr Handy vertieft, aber die Leine lässt sie trotzdem nicht locker. Also schauen wir uns aus mittlerer Entfernung an, der Hund und ich, beide ein wenig enttäuscht. Er, weil er so nicht an Essen kommt und ich, weil ich gern wüsste, ob er so flauschig ist, wie er aussieht.
Je weiter die Sonne untergeht, desto leerer wird es im Nachtzug nach Italien. Der junge Mann, der schon in Wien Meidling in unserem Abteil war, sitzt immer noch da. Als wir nur noch zu dritt sind, kommen wir mit ihm ins Gespräch. Er erzählt uns auf englisch, dass er vom Flughafen kommt und heute eigentlich nach Großbritannien fliegen wollte. Dann ist aber bei seinem Corona-Test etwas schiefgelaufen und er konnte kein gültiges Ergebnis vorlegen. Morgen versucht er es also nochmal. Er steigt in Bruck an der Mur aus.
Wir fahren weiter und ziehen, endlich allein, alle Sitze aus. Jetzt können wir uns hinlegen und aus dem Fenster schauen. Ein österreichisches Kaff nach dem anderen zieht an uns vorbei. Wir lassen Mini-Bahnhöfe und etwas größere, Dorfkirchen und Felder hinter uns. Sie sind das Letzte, was ich vorm Einschlafen sehe. Erst um etwa halb drei Uhr morgens will wieder jemand etwas von uns. Der Zug steht an der Grenze zu Italien und ich höre, wie jemand durchgeht und die Schiebetüren neben uns nacheinander mit einem lauten „Wumms“ geöffnet werden. Wir kramen schon einmal nach unseren Pässen und erwarten, unsere negativen Testergebnisse herzeigen zu müssen. Nichts da. Eine Frau in italienischer Beamtenkleidung macht unsere Tür auf, leuchtet kurz mit ihrer Taschenlampe herein, nickt und schließt die Tür wieder. Wofür war das denn gut? Wie hätten wir aussehen müssen, dass sie uns nach unseren Pässen fragt? Was hätten wir tun müssen, damit sie unsere Tests kontrolliert?
Schokokrapfen am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
Als ich das nächste Mal wach werde, schauen die Häuser schon südländischer aus. Um kurz nach fünf steigen wir am Hauptbahnhof in Bologna aus. Es ist so früh, dass weder ein Informationsschalter, noch irgendein Coffee-Shop offen hat. Also schleppen wir unser Gepäck zum nächstgelegen Park, der eigentlich auch noch zu hat, aber für den wir einen Schleichweg finden. Wir breiten unsere Picknickdecke auf der Wiese aus und legen uns hin, um noch eine Runde zu schlafen. Ich bin so müde, dass ich mich ein wenig benommen fühle. Die Blätter der Bäume über uns bewegen sich lustig, denke ich. Ich fühle mich ein wenig verrückt dafür, um diese Uhrzeit in einem noch geschlossenen Park zu liegen und Blätter zu beobachten, aber mag das Gefühl auch irgendwie.
Nach einer Weile kommen die ersten joggenden oder mit ihren Hunden Gassi-gehenden FrühaufsteherInnen an uns vorbei. Manchen fallen wir gar nicht auf, andere schauen uns ein wenig verdutzt an. Mein Freund ist mittlerweile hungrig geworden und macht sich auf die Suche nach einer Bäckerei. Ich bleibe hier und passe auf unser Gepäck auf. Eine Viertelstunde später kommt er mit zwei Kaffeebechern, Pizzastücken und Schokokrapfen wieder und ich weiß gar nicht, worüber ich mich am meisten freue.
Nach unserem Frühstück geben wir unsere Koffer für zehn Euro in einem Fahrradgeschäft ab, weil wir noch nicht in unsere Unterkunft können. Dann machen wir uns auf den Weg zur Kathedrale von Bologna, wo wir mit Ela zu einem Stadtspaziergang verabredet sind. Wie viele andere auch, bietet sie Free Walking Tours nach dem „Zahl-soviel-du-willst“-Prinzip an. Kurz vor der Tour sind wir erschöpft und unmotiviert. Außerdem können wir unseren Guide irgendwie nicht finden. Wir laufen zweimal an ihr vorbei, bevor wir sie erkennen. Die junge Kroatin begrüßt uns herzlich in ihrer Stadt, in die sie der Liebe wegen gezogen ist.
Die Stadt mit drei Namen
Es scheint, als hätte sie sich aber nicht nur in einen Bolognesen, sondern auch in Bologna selbst verliebt. Mit leuchtenden Augen und einem konstanten Lächeln auf den Lippen erzählt sie uns, was welche Statuen bedeuten und welche Geschichten es zu den alten Gebäuden gibt. Während dem Spaziergang werde ich langsam wach und bin plötzlich baff von der Schönheit dieser Stadt, die laut Ela drei Namen hat. „La Dotta“ (die Gelehrte), wegen der jahrhundertealten Universität, die Bologna zu einer modernen Studentenstadt macht. „La Rossa“ (die Rote), aufgrund der Ziegelmauern und roten Dächer. Und „La Grassa“ (die Fette), bezieht sich auf die fettigen, traditionellen Gerichte.
Auch Ela redet gern über die Küche Bolognas. Sie schwärmt von guten Weinen, Reiskuchen und ihrer liebsten Aperitif-Bar. Außerdem erklärt sie uns, dass Tortellini und Tortelloni auf keinen Fall das gleiche sind und man in Bologna niemals „Spaghetti Bolognese“ bestellen darf. Das verärgere die Bedienung nur, denn hier heißt das Gericht „Tagliatelle al Ragu“ und wird mit dickeren Nudeln zubereitet. Als Vegetarierin finde ich es gar nicht so schlimm, dass ich hier keine Spaghetti Bolognese essen kann. Generell ist die Küche Bolognas sehr fleischlastig, lerne ich. Zu den Spezialitäten zählen etwa die über die Grenzen hinaus beliebte Wurstsorte Mortadella oder „Cotoletta alla bolognese“, eine Art Schnitzel mit Rohschinken und Fleischbrühe.

Arkaden und Aperitif
Während der Tour müssen wir immer mal wieder stehenbleiben, weil ich einfach nicht aufhören kann, meine Kamera zu zücken. Bologna ist eine der fotogensten Städte, die ich bisher besucht habe. Der orange Farbton der Gebäude und die vielen, lachenden Gesichter geben ihr eine warme Atmosphäre, in der ich mich gleich wohl fühle. Besonders beeindruckend sind die vielen Arkadengänge, die überall zu finden sind. Insgesamt erstrecken sie sich auf fast 40 Kilometer und sind vor allem an Regentagen sehr nützlich. Der Grund für diese spezielle Bauweise geht ins Mittelalter zurück. Damals zogen viele Studierende und Lehrende aufgrund der neugebauten Universität nach Bologna, die alle nach einer Bleibe suchten. Durch die Arkadenbauten schuf man daher neuen Wohnplatz. Heute sind sie ein Wahrzeichen der Stadt und wurden sogar für die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes nominiert.

Nach der Tour mit Ela machen wir uns auf den Weg in unser gemietetes Apartment, das sich etwa 25 Minuten von der Innenstadt entfernt befindet. Wie in den meisten Wohnhäusern Italiens gibt es keinen Lift und das Treppensteigen wird für die nächsten Tage unser tägliches Workout, mit dem wir in unsere kleine Dachgeschoßwohnung kommen. Nachdem wir angekommen sind und die zwei Zimmer inspiziert haben, entscheiden wir uns erstmal für einen Power Nap. Den späten Nachmittag und Abend wollen wir auf italienische Art und Weise verbringen und machen uns auf die Suche nach einer Aperitif-Bar. Die Idee hatten auch viele andere, denn die meisten Lokale mit Außensitzplätzen sind gut gefüllt. Wir finden aber einen schönen Platz in einer Osteria auf dem Piazza San Stefano, die uns Ela am Vormittag schon empfohlen hatte. Ich schaue mich um und habe den Eindruck, dass es für mich fast nur eine Getränkeoption gibt: Aperol, denn den trinken auch alle anderen hier.
Zum Aperitif werden in Italien meist kleine Snacks serviert, in diesem Fall Kartoffelchips und Oliven. Letztere kann ich zwar nicht ausstehen, aber trotzdem finde ich, dass Aperitif auch in Österreich zur Gewohnheit werden sollte. Die ItalienerInnen scheinen ihre späten Nachmittage voll und ganz zu genießen – an diesem Wochenende wohl ganz besonders, denn erst kürzlich wurden die Corona-Maßnahmen für italienische Lokale gelockert. Um mich herum strahlen die Augen in lächelnden Gesichtern. Es werden angeregte Gespräche geführt und zur Unterstützung wild Mimik und Gestik eingesetzt. Ein Aperol nach dem anderen verschwindet und bald gehen viele zum Abendessen über. Ich esse das vielleicht beste Pasta-Gericht meines Lebens und anschließend lassen wir den Abend noch gemütlich auf dem beleuchteten Hauptplatz „Piazza Maggiore“ ausklingen.

Let’s go to the beach!
Tag 2 beginnt mit einem unliebsamen Geräusch, nämlich dem meines Handyweckers. 9 Uhr, Zeit zum Aufstehen. Wir packen unsere Rucksäcke, setzen unsere Sonnenbrillen auf und schlendern zum Bahnhof. Als wir im Zug nach Ravenna sitzen und ich aus dem Fenster schauend an meinem unterwegs gekauften Cappuccino schlürfe, komme ich im Urlaub an. Ich brauche immer ein wenig, um zu realisieren, dass ich an einem neuen Ort bin. Anfangs fühlt sich alles wie ein Traum an. Als mir klar wird, was für ein Tag heute auf mich wartet, kann ich auf einmal nicht mehr aufhören zu grinsen. Vom Bahnhof in Ravenna geht es für uns mit dem Bus zum Strand Punta Marina, wo ich als sofort meine Turnschuhe und Socken ausziehe.
Das Gefühl, als meine Füße zum ersten Mal den weichen Sand berühren, lässt mein Herz schneller schlagen. Wir gehen einen kleinen Hügel hoch und schon erstreckt sich das adriatische Meer vor uns. Nachdem wir einen Platz nahe am Wasser gesucht und dort unsere Handtücher ausgebreitet haben, nehme ich die anderen Leute wahr. Es sind nicht viele und die meisten haben sich Liegestuhl und Sonnenschirm gemietet. Manche sind braungebrannt, während andere so aussehen, als wäre das auch ihr erster Strandbesuch heuer.

Wir streifen unsere Kleidung ab und tapsen in Richtung Meer. Das Wasser ist wärmer als erwartet und wir schwimmen raus, bis uns Felsen im Weg stehen. Wir wollen sie beklettern und uns auf ihnen sonnen lassen, doch eine riesige Krabbe sitzt auf einem Stein und lässt mich lieber wieder zurück zum Ufer schwimmen. Beim Rausgehen fallen mir die vielen kleinen Quallen auf. Die meisten von ihnen schimmern weißlich-durchsichtig und sind bereits tot. Während ich darüber nachdenke, woran sie wohl gestorben sind, gehe ich zu unserem Platz zurück und finde auf dem Weg dorthin haufenweise schöne Muscheln. Von da an suche ich mir eine ganze Sammlung zusammen. Kleine und große, gemusterte und einfärbige. Ich plane, aus ihnen ein Armband oder eine Halskette zu machen. Gleichzeitig sagt ein Teil von mir „Das machst du eh nicht wirklich!“. Und vielleicht hat er recht. Vielleicht liegen die Muscheln dann irgendwo in meiner Wohnung herum und warten auch noch in zehn Jahren darauf, zu etwas noch Schönerem verarbeitet zu werden. Denn auf Reisen tendiere ich zu kreativen Einfällen und sprühe nur so vor Ideen für zukünftige Projekte, die ich dann nie angehe. Immer, wenn ich daheim ankomme, schafft die Realität es, mir meine Motivation zu nehmen. Da sind dann so viel wichtigere Dinge, die es zu erledigen gilt, als Muscheln auszusortieren, ein kleines Loch in sie zu bohren und sie auf eine Schnur zu fädeln. Dabei wäre es genauso einfach, wie es sich anhört.
Ich grabe also auf meinem Handtuch sitzend nach Muscheln und liebe es, wie zart sich der Sand auf meinen Händen anfühlt. Generell mag ich es, Sachen zu spüren, nehme mir aber zu wenig Zeit dafür. Vielleicht sollte ich auf manche meiner Sinne besser achtgeben.
Beim Einkaufen nicht nur daran denken, wie ein Outfit aussieht, sondern auch, wie es sich an meinem Körper anfühlt. Einen Film nicht nur sehen, sondern ihn stärker hören. Mein Abendessen heute einmal nicht nur schmecken, sondern davor ausgiebig daran riechen und es anschauen. Ich schließe meine Augen, weil ich den Moment auf andere Weise einfangen will. Wind bläst mir ins Gesicht, dessen Lippen salzig und sandig schmecken. Ich höre Meeresrauschen und ein paar italienische Wortfetzen, von denen ich leider nichts verstehe, weil ich im Italienischunterricht besser hätte aufpassen sollen. Nicht weit weg von uns hat jemand etwas zu essen ausgepackt und ich versuche ein paar Minuten lang herauszufinden, worum es sich bei dem Geruch handelt. Als ich es nicht herausfinde und meine Augen öffne, um nachzusehen, isst der Mann schon nicht mehr. Ich werde es also nie wissen und ärgere mich nur ein bisschen darüber.
Während mein Freund auf seinem Handtuch neben mir eingeschlafen ist, krame ich mein mitgebrachtes Buch heraus. Lesen kommt mir im Urlaub immer ganz anders vor, als daheim. Viel intensiver und schöner. Man ist sozusagen doppelt in einer anderen Welt. Einmal physisch und dann nochmal gedanklich, vielleicht macht das den Reiz für mich aus. Den restlichen Tag verbringen wir damit, lange auf unseren Zug zu warten, weil wir den geplanten Bus versäumt haben, uns über unsere starken Sonnenbrände zu ärgern und am Abend müde ins Bett zu fallen.
Ballons, Katzen und Wirbelstürme
Der Samstag ist der einzige Tag, an dem wir ausschlafen können. Als wir am Vormittag aufwachen, weiß ich noch nicht, dass ich heute 27.000 Schritte gehen werde. Nach einem Sprung zum Bäcker suchen wir uns einen kleinen Park in der Nähe unserer Wohnung und picknicken dort erstmal ausgiebig Brot, Käse und Tomaten. Nebenbei hören wir eine Spotify-Brunch-Playlist und finden sie gar nicht schlecht. Nach dem Essen liegen wir eine Weile auf dem Rücken, planen unseren Tag und beobachten die anderen Parkbesucher.
Ein Mann spielt mit einem Kind fangen, knickt dabei um und kommt kurz ins Wanken, schafft es aber, sein Gleichgewicht zu halten. Sein erleichterter Gesichtsausdruck ähnelt dem meinen, als ich die Szene beobachte. Rechts neben uns hat sich eine Gruppe junger Frauen versammelt, die alle pinke T-Shirts tragen. Eine hat einen weißen Schleier auf und ich frage mich, ob sie gerade mit dem Junggesellinnenabschied beginnen oder er hier nach einer langen Nacht endet. Für zweiteres würden sie noch relativ fit aussehen, vielleicht können Italienerinnen aber auch einfach besser feiern als meine Freundinnen und ich. Hinter uns spielt eine Männergruppe Fußball und ein kleiner Junge fährt mit Hochgeschwindigkeit auf seinem Rad durch den Park. Er scheint extrem fokussiert zu sein und die Art, wie er sich in die Kurven legt, lässt mich an eine Rennfahrerkarriere für ihn glauben.
Eigentlich wollten wir heute die Kirche „Santuario di San Luca“ besichtigen, die man mit einer Art Arkaden-Pilgerweg erreicht. Dafür kommt es uns aber auf einmal viel zu heiß vor und wir beschließen, stattdessen in der Innenstadt bummeln zu gehen. Auf dem Weg zu einem Geschäft, das ich schon vorgestern gesehen und gern besuchen würde, kommen wir an einem Maler vorbei. Er ist nicht der Einzige, der auf dieser Straße seine Stücke ausstellt, aber der, dessen Bilder mir sofort ins Auge springen. Es handelt sich um kleinere und größere Kunstwerke mit verschiedenen Motiven. In fast allen spielt Bologna eine Rolle. Entweder sind rote Dächer zu sehen oder die Türme, für die die Stadt noch bekannt ist. Auch Heißluftballons scheint er gern zu zeichnen, Bücher, Wirbelstürme und Katzen ebenfalls. Eine lustige Kombi, denke ich.
Der weißhaarige, schlaksige Mann mit Mütze, der rein optisch wirklich allen Künstlerklischees entspricht, erzählt uns mit Begeisterung, was er mit seinen Werken aussagen möchte. Bildung scheint ihm ein großes Anliegen zu sein und die Bücher sollen die Weisheit Bolognas symbolisieren. Katzen mag er wohl einfach gern. Ein Bild hat es mir schnell besonders angetan. Zwei Menschen fliegen dabei in einem Heißluftballon über die Dächer Bolognas. Bücher und Katzen sind hier zwar keine vorhanden, aber man kann nicht alles haben. Nach langem Überlegen kaufe ich mir also mein allererstes Kunstwerk und kann gar nicht aufhören, es anzuschauen, während ich es durch die Straßen schlendernd vor mir hertrage. Auf dem Heimweg machen wir noch einen Zwischentopp, um im Gastgarten eines kleinen Cafés Cappuccino zu trinken. Als die Kellnerin zu uns kommt, sieht sie mein Bild und ist auf einmal sehr aufgeregt. „Venire!“, ruft sie und deutet uns, ins Innere des Lokals zu kommen. Wir kennen uns nicht aus und folgen ihr zögerlich. Drinnen angekommen, zeigt sie uns stolz ein Bild, das dem meinen stark ähnelt und eindeutig vom gleichen Künstler stammen muss. Dieses beinhaltet zwar gleich drei Katzen, aber meins finde ich trotzdem noch schöner.

Also doch noch hoch hinaus
Um etwa vier Uhr nachmittags kommen wir in unserer Wohnung an und ich will gerade ein Nickerchen vorschlagen, als mein Freund mich überreden will, doch noch zur Kirche raufzugehen. Eigentlich habe ich darauf keine Lust, aber andererseits werde ich die Gelegenheit, hier zu sein, nicht mehr so schnell bekommen. Also stimme ich zu, wir ziehen uns gemütliche Kleidung an und machen uns auf den Weg. Die Hitze macht mich noch müder und wir kommen nur langsam voran. Wir brauchen schon ziemlich lange zum eigentlichen Start des Arkaden-Pilgerwegs, von dem es dann stetig bergauf geht.
Viele Menschen kommen uns von oben entgegen und überholt werden wir auch ein paar mal. Für manche Leute scheint dieser Weg ein Workout zu sein, sie joggen rauf oder gehen mit an Händen und Beinen festgemachten Gewichten nach oben. Viele Trinkpausen später stehe ich schwitzend und mit hochrotem Kopf vor einer wunderschönen Aussicht auf Bologna. Rundum die Kirche haben sich Menschen allen Alters in kleinen Grüppchen versammelt. Sie alle sind heute denselben Weg gegangen, um jetzt den Ausblick und die Atmosphäre hier zu genießen. Ich finde es schön, für eine halbe Stunde Teil dieser Szenerie zu sein und fühle mich den anderen auf komische Art und Weise verbunden, während ich staunend die Häuser der Stadt betrachte.

Vorbereitung ist nicht alles
Für den Abend haben wir einen Tisch in einem Lokal reserviert, das ich schon vor dem Urlaub auf einem Reiseblog gefunden habe. Es wurde von der Verfasserin des Artikels hochgelobt und soll laut ihr ein Insidertipp sein, den sonst nur Einheimische kennen. Klingt gut, dachte ich und habe es aufgeschrieben. Google Maps zeigt uns an, dass wir etwa eine halbe Stunde hinbrauchen, und führt uns in eine Gegend der Stadt, in der wir zuvor noch nicht waren. Wir kommen an kleineren Plätzen vorbei, wo junge Leute zusammensitzen, plaudern und teilweise auch tanzen. Es muss wohl das Univiertel sein, stellen wir fest. Als wir bei der gesuchten Osteria ankommen, sieht sie so gar nicht einladend aus.
Es gibt keine Möglichkeit draußen zu sitzen, der Innenraum sieht dunkel und ungemütlich aus und obwohl es schon neun Uhr abends ist, ist das Restaurant menschenleer. Deshalb entscheiden wir uns schnell dazu, doch etwas anders zu suchen und ich habe auch schon etwas im Kopf. Wir sind am Weg hierher an einem kleinen, mit Lichterketten beleuchteten Lokal vorbeikommen, zu dem wir jetzt gehen. Glücklicherweise haben sie draußen noch ein paar Plätze frei und als wir die Speisekarte lesen, sind wir ganz überrascht von den vielen vegetarischen und veganen Gerichten, die auch preislich sehr in Ordnung sind. Spätestens nach der wirklich guten Vorspeise wissen wir, dass wir hier etwas sehr Schönes gefunden haben und freuen uns, als hätten wir im Lotto gewonnen. Das Lokal liegt in einer ruhigen Straße und man kann sich hier viel besser unterhalten als in einem Innenstadtrestaurant. Nach dem Trubel der letzten Tage schaffe ich es hier, etwas runterzukommen und die vielen neuen Impressionen zu verarbeiten. Ich finde es lustig, dass ich im Vorhinein so viel zu dieser Stadt recherchiert habe.
Für jeden Abend hatte ich ein Lokal mit super Bewertungen parat. Im Endeffekt waren wir in keinem einzigen davon, andererseits wären wir ohne den Blogbeitrag wahrscheinlich niemals im Univiertel und schon gar nicht in diesem netten Veggie-Restaurant gelandet. Es sollte wohl einfach so sein.
Natalie
An unserem letzten Tag in Bologna haben wir ein kleines Gepäckproblem. Wir müssen unsere Wohnung schon um 10 Uhr vormittags verlassen und können unsere Koffer nicht mehr dort lassen. Der Zug nach Hause geht aber erst um Mitternacht und am Bahnhof gibt es nirgendwo Schließfächer, um unser Zeug einzusperren. Also geben wir es wieder wie am ersten Tag bei einem Fahrradgeschäft ab, müssen es hier aber schon um 7 Uhr abends wieder holen und 15 Euro bezahlen.
Wir lernen außerdem, dass sonntags viele Bäckereien Bolognas geschlossen haben, finden aber eine kleine Hipster-Bäckerei, wo wir überteuertes, aber sehr gutes Brot kaufen. Wir frühstücken in demselben Park, in dem wir an unserem Ankunftstag frühmorgens noch ein Nickerchen gemacht haben. Nebenbei können wir einer Sängerin dabei zuhören, wie sie die allerhöchsten Oktaven eines Opernlieds schmettert. Wir sehen sie zwar nicht, aber überhören kann man ihre Einlagen auf keinen Fall. Phasenweise klingt ihre Stimme so unnatürlich, dass ich Angst um die Lunge der Frau habe, aber so macht man das in ihrem Job wohl. Ich frage mich, wie sie aussieht und ihr Gesichtsausdruck während dem Singen. Verzerrt? Konzentriert? Angespannt? Das ist wahrscheinlich sehr klischeehaft, aber wenn ich an Opernsängerinnen denke, ähneln sie fast immer ein wenig Anna Netrepko – lange, dunkle Haare, ein durchdringender Blick und ein etwas rundliches und stark geschminktes Gesicht. Deshalb beschließe ich, mir diese Frau ganz anders vorzustellen. Mit einem roten Bob und Sommersprossen. Sie heißt Natalie und kommt aus Großbritannien. Es ist einer ihrer ersten Auftritte, deshalb wirkt sie auf der Bühne noch etwas unsicher. Bei den hohen Tönen schließt sie ihre Augen, während ihre rechte Hand das Mikro fester umklammert und sie leicht in die Knie geht. Die linke Hand liegt lässig auf dem Stoff ihres schwarzen, ausgefransten und enganliegenden Sommerkleids. Ihr Oberkörper ist fast vollständig mit Tattoos bedeckt und wenn sie den Mund beim Singen weit aufmacht, blitzt ihr Zungenpiercing hervor. So eine Opernsängerin würde ich gern einmal sehen, denke ich. Und obwohl ich natürlich dazu verleitet bin, schaue ich absichtlich nicht nach, wie Natalie wirklich aussieht.
Viele Stufen und moderne Kunst
Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg zu unserer letzten richtigen Touristenattraktion, dem Asinelli Tower. Mehr als 500 Stufen stehen zwischen uns und einem Ausblick, den wir uns nicht entgehen lassen wollen. Also stapfen wir schnaufend bis ganz nach oben und ich bekomme bei dem knarzenden Geräusch unter meinen Füßen ein bisschen Gänsehaut. Schließlich sind wir in Italien und man hört ja immer wieder, dass hier Dinge einfach zusammenfallen. Natürlich stürzen wir aber nicht in die Tiefe und erreichen den Aussichtsspot, von dem aus man über ganz Bologna sieht. Mit einem Mal werde ich traurig, dass heute schon unser letzter Tag angebrochen ist. Ich habe das Gefühl, noch immer nicht zu hundert Prozent hier angekommen zu sein und wünsche mir, mich einleben und nicht nur die offensichtlichen Seiten dieser Stadt kennenlernen zu können. Dazu müsste ich mit Stadtbewohner*innen sprechen und sie fragen, wie das Leben hier wirklich ist. Dafür habe ich zu wenig Zeit, aber mein Bauchgefühl sagt mir ohnehin, dass ich noch einmal herkommen werde. Man sieht sich immer zweimal, sage ich also in Gedanken zu Bologna, nicke ihr noch einmal zu und gehe dann die 500 Schritte zurück nach unten.

Für den letzten Programmpunkt haben wir uns das moderne Kunstmuseum ausgesucht. Wir sind beide nicht allzu große Kunstkenner und wissen noch nicht ganz, was uns erwartet. Der Eintritt ist für Studierende aber gratis, also überlegen wir nicht lang. „Safe and Sound“ heißt die aktuelle Ausstellung dort, die ein italienischer Künstler kuratiert hat. Drinnen angekommen stehen wir erst einmal planlos vor einer kleinen Tribüne und einer Leinwand, auf der auf einer ähnlichen Tribüne sitzende Menschen gezeigt werden. Wir starren auf die Leinwand und es wirkt, als würden die Leute uns sehen und direkt zurückstarren. Im nächsten Raum sind verschiedene Bilder zum Thema Sicherheit ausgestellt. Ein Mann, der einen Security-Guard umarmt. Die Wachen vor dem Buckingham Palace. Auf einem Bild erkennen wir Wien. Eine kleine Menschengruppe läuft über einen Zebrastreifen und ein Mann hält ein Plakat in der Hand, auf dem „THE END IS NEAR“ zu lesen ist. Während wir uns das genauer anschauen und rätseln, wo in Wien das Bild entstanden sein könnte, kommt ein Museumsmitarbeiter zu uns. Im Falle eines Notfalls sollen wir nur an die anderen Gäste denken, sagt er in gebrochenem Englisch zu uns. Wir verstehen nicht recht, was er damit meint. Das ist ihm aber egal, er dreht sich gleich danach wieder um und legt sich in Raummitte auf den Boden.
Ich schaue mich um und merke erst jetzt, dass die MitarbeiterInnen wohl Teil der Ausstellung sein müssen. Wenig später sagt eine Frau zu mir, ich solle unbedingt ganz nahe an den Wänden gehen. Mein Freund findet ein Kärtchen auf dem Boden. Darauf steht, dass es zur Ausstellung gehört und wir es irgendwo im Museum wieder ablegen sollen. Wir finden noch weitere Kärtchen, mit Aufgaben. Wir sollen uns auf den Boden legen und die Decke anstarren. Oder etwas wie ein Kunstwerk betrachten, das offensichtlich keins ist. Mein Lieblingskärtchen: Stell dir vor, alle anderen Museumsgäste wären Tiere, während du durch die Ausstellung gehst. Nicht nur die MitarbeiterInnen sind also Teil der Kunst, sondern auch wir als BesucherInnen. Das wird auch dann besonders klar, als wir in einen ähnlichen Raum wie dem ersten kommen, mit Leinwand und Tribüne. Wir sehen andere Museumsgäste dort und sie sehen uns, denn eine kleine Kamera überträgt uns, wie wir auf dieser Tribüne sitzen. Deshalb können wir ihnen auch in die Augen schauen.
Späte Erkenntnisse
Nach einem letzten Abendessen ist es auch schon Zeit, Bologna wieder zu verlassen. Auf dem Weg zum Bahnhof gehen wir an wahnsinnig vielen Obdachlosen vorbei. Alle paar Meter sehen wir Menschen, deren ganzes Hab und Gut sich in wenige Plastiksackerl stopfen lässt. Sie haben ihre Matratzen dorthin gelegt, wo viele Leute vorbeigehen, damit diese vielleicht ein paar Münzen in die Becher und Schüsseln vor ihnen werfen. Ich bemerke erst jetzt, dass die Arkaden nicht nur beeindruckende Architektur sind, sondern für manche Menschen das Dach über dem Kopf bilden.
Nach vier Tagen purem Luxus wird mir erst am letzten Abend bewusst, wie privilegiert ich eigentlich bin. Wie unfair es ist, dass ich als Studentin einfach so hier Urlaub machen kann. Wie falsch es ist, dass ich an diesem einen langen Wochenende so viel Geld für Schnickschnack ausgegeben habe, während Leute vielleicht wochenlang davon hätten leben können. Mit einem Mal fühle ich mich schlecht und will nach Hause, was mir ein noch schlechteres Gefühl gibt, weil ich ja im Gegensatz zu den Obdachlosen ein zuhause habe und auch dafür viel zu undankbar bin. Also verliere ich mich in einer gedanklichen Schuldgefühlsspirale und schaue schweigend dabei zu, wie lachende und alkoholisierte Tourist*Innen an den scheinbar schlafenden Obdachlosen vorbeilaufen. Sie bemerken sie gar nicht, aber ich bemerke jetzt, wie nah Reichtum und Armut hier zusammenkommen. Und dass diese Stadt in Wahrheit viel wichtigere Geschichten zu erzählen hat, als die, die ich schreiben werde.
Sarahs Tipps: Restaurants
- Die 051 Osteria Santo Stefano befindet sich direkt auf dem eindrucksvollen Piazza San Stefano und ist eins der wenigen Lokale dort, die preislich halbwegs in Ordnung sind. Aufgrund der schönen Lage ist das Restaurant meist gut besucht und man kann gut Leute schauen. Empfehlenswert sind die „Tortelloni di Ricotta“ und die „Tagliatelle al Ragu“ um jeweils etwa 10 Euro.
- Auch auf der belebten Via degli Orefici kommen Gäste, die gern unter anderen Menschen sind, auf ihre Kosten. In der Osteria Angelo degli Orefici kann man bei normalen Preisen aus einer großen Auswahl an italienischen Gerichten und Süßspeisen auswählen.
- Das Clorofilla im Univiertel ist definitiv mein Lieblingsrestaurant in Bologna. Die Karte beinhaltet nur vegane, vegetarische und Fisch-Gerichte, was in dieser Stadt nicht allzuoft vorkommt. Bei schönem Wetter kann man hier im Schein von Kerzen und Lichterketten draußen zu Abend essen. Es herrscht Ruhe und eine gute Redeatmosphäre, das Personal ist sehr freundlich. Probiert auf jeden Fall die Gnocchetti mit Kürbis und die mit Parmesan überbackene Melanzani!
- In Bahnhofsnähe befindet sich das Ristorante il Moro, wo man unter anderem sehr gute Pizza bekommt. Die Atmosphäre ist dort aufgrund der klassisch italienischen Restauranteinrichtung wahnsinnig nett und die Kombination mit lauter Clubmusik erzeugt gute Stimmung.
Sarahs Tipps: Bäckereien
- Die Fiorini Gaetano ist Elas Lieblingsbäckerei. Wir haben dort gutes Weißbrot zum Frühstück gekauft, aber sie haben dort auch viele süße Speisen, wie zum Beispiel traditionelle „Torta di riso“.
- Direkt neben unserer Unterkunft fanden wir die kleine Bäckerei Piron el furner, wo wir ebenfalls Gebäck und eine Art dünnes Pizzafladenbrot kauften. Auch hier kann man seinen Guster auf Süßes stillen, die Auslage ist mit Keksen, Croissants und Küchlein gefüllt.
- Da sonntags einige Bäckereien zu haben, war die Forno Brisa die dritte, die wir ansteuerten. In dieser Hipster-Bäckerei bekommt man kreative Kreationen in süß und sauer, sowie wirklich gutes Brot. Man zahlt aber dementsprechend viel dafür.