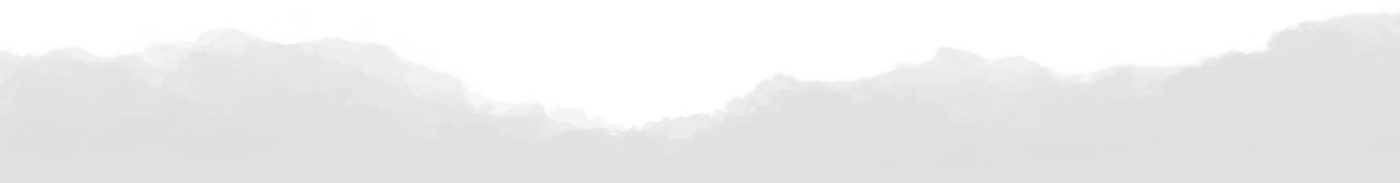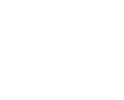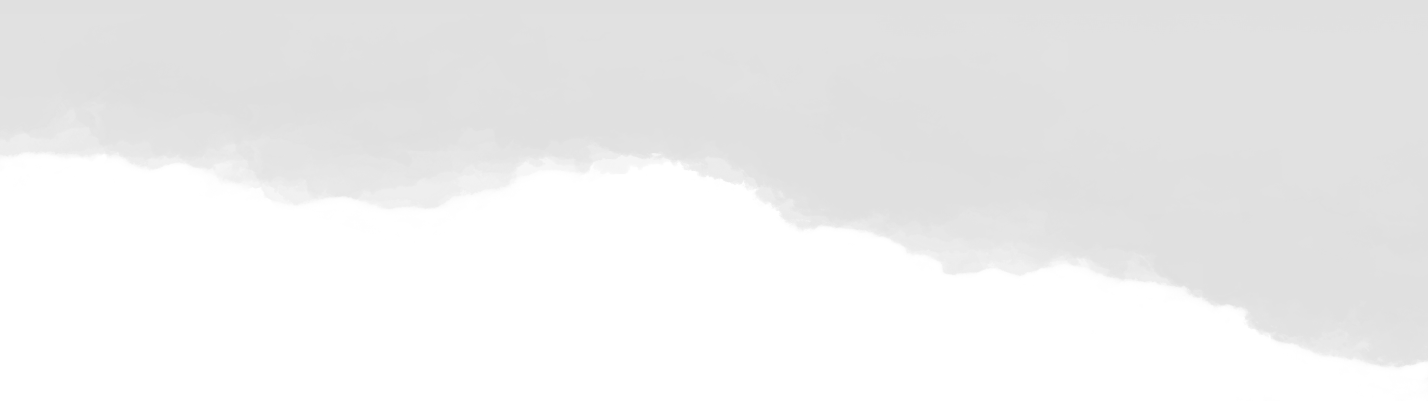Diberney ist gegen den Frieden. Der Flüchtling aus Kolumbien mit der sanften Stimme arbeitet für eine katholische Menschenrechtsorganisation und hat ein Projekt namens „Junge FriedensstifterInnen“ initiiert. Auf die Frage „Sind Sie für das Abkommen zur Beendigung des Konflikts und zur Schaffung eines sicheren und nachhaltigen Friedens?“ hat Diberney aber eine klare Antwort: „No.“
Alles war für den Frieden bereit. „Es lebe der Frieden! Es lebe Kolumbien!“, hatte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon den begeisterten KolumbianerInnen zugerufen. Ganz in weiß gekleidet hatten sich Präsident und Rebellenführer nach Jahren der Feindschaft die Hände geschüttelt. Ein halbes Jahrhundert des Krieges war vorüber, zum ersten Mal in der Geschichte herrschte Frieden in der gesamten westlichen Hemisphäre. Die Welt schöpfte wieder Hoffnung, als die beiden Männer nach vier Jahren intensiver Verhandlungen feierlich ihre Namen unter das Abkommen setzten. Der Friedensnobelpreis war in Reichweite. Nur an eines hatte keiner gedacht: an das Volk.
Denn die KolumbianerInnen stimmten am 2. Oktober mit einer hauchdünnen Mehrheit gegen den schon abgeschlossenen Friedensvertrag zwischen Regierung und FARC. Nach einem starken Finish der Kampagne rund um Expräsident Álvaro Uribe setzte sich das No-Lager überraschend durch. Präsident Juan Manuel Santos und Guerillaführer Rodrigo Londoño, besser bekannt unter seinem Kampfnamen „Timoschenko“, zeigten sich über den Ausgang des Referendums entsetzt. Keiner der beiden will den Krieg, doch das Schicksal Kolumbiens liegt jetzt nicht mehr allein in ihren Händen. Der Waffenstillstand sei nur noch bis zum 31. Oktober in Kraft, verkündete Santos. Worauf Londoño die Frage stellte, die das ganze Land beschäftigt: „Und dann geht der Krieg weiter?“
„Möge Gott ihnen vergeben“
Vielleicht kennt Diberney die Antwort. Der 26- jährige kolumbianische Flüchtling sitzt auf einer Straßenmauer in Ibarra, einer mittelgroßen Stadt im Norden Ecuadors. „Das Ergebnis spricht für sich“, meint er, „es zeigt, was wir mitgemacht haben.“ Diberney gehört zu den 57.000 KolumbianerInnen, die ins südliche Nachbarland geflohen sind. „Ich kam mit nichts als den Kleidern an meinem Leib.“ Der Konflikt in Kolumbien hat 6,7 Millionen Menschen zu Vertriebenen gemacht, fast so viele wie der Krieg in Syrien.
Doch auch in Ecuador sind die Flüchtlinge nicht willkommen. KolumbianerInnen gelten als faul und unehrlich, kaum eine Bank will den AusländerInnen Geld borgen. Da aber viele nicht als AsylwerberInnen registriert sind, haben sie Angst, sich gegen die allgegenwärtigen Schikanen zu beschweren. „Das Geld“, bemerkt Fabian Rivera, der in Ibarra als Kellner arbeitet, „reicht gerade einmal zum Überleben.“ Kommt die Rede auf den Friedensvertrag in ihrem Heimatland, dann werden viele Flüchtlinge wütend. „Una gran mentira“, heißt es ein ums andere Mal, alles nur eine Lüge.

An eine Zeit, in der Frieden in Kolumbien herrschte, kann sich keiner der Flüchtlinge erinnern. 1964 wurde die Rebellenarmee FARC von radikalen Kleinbauern gegründet. Die Wurzeln des Konflikts liegen aber noch tiefer: im Landraub der spanischen Eroberer, der Vertreibung der Indios, der Versklavung der AfrikanerInnen. Finanziert von Drogenschmuggel und Entführungen avancierte die FARC bald zu einer stramm organisierten Guerillatruppe, die dem Militär im unzugänglichen Dschungel des Südens keine Chance ließ. Regelmäßige Regierungsoffensiven ab der Jahrtausendwende zwangen die RebellInnen auf den Verhandlungstisch. Die Zahl ihrer KämpferInnen hatte sich da schon auf 8.000 halbiert.
Das vorgeschlagene Abkommen beinhaltete nun eine Generalamnestie für alle TerroristInnen, die ihre Waffen abgeben, und sah selbst für Verbrechen gegen die Menschlichkeit eine Höchststrafe von nur acht Jahren vor. Das findet Ehblarte Aguirre ungerecht: „Möge Gott ihnen vergeben. Ich kann es nicht.“ Der FARC wurden zudem fünf Sitze im kolumbianischen Senat und damit der Zugang zur Parteienfinanzierung zugesichert. Und schließlich gelang es den marxistischen Guerilleros nach 50 Jahren doch noch, eines ihrer anfänglichen Ziele zu erreichen: eine Landreform, wenn auch in viel kleinerem Ausmaß als erhofft. Für viele ExpertInnen eine dringend notwendige Maßnahme. Andere hingegen sehen die Landreform als ersten Schritt zu einem sozialistischen Chaos à la Venezuela. Aguirre fasst die Wut vieler Flüchtlinge zusammen: „Das Land zu verraten, den Tyrannen die Freiheit zu schenken und uns einem kommunistischen Regime zu unterwerfen – das ist kein Frieden.“
Der Fluch des Krieges
Und selbst wenn es Frieden mit der FARC geben sollte – die Gewalt in Kolumbien ist damit noch lange nicht vorbei. Insgesamt sollen bloß ein Zehntel der im gesamten Krieg verübten Gewalttaten auf das Konto der FARC gehen. Die kleinere katholisch-marxistische ELN kämpft schon genauso lange, 80 Prozent der Massaker kamen aber laut einer von der Regierung eingesetzten Kommission nicht von links. Die meisten der über 220.000 Toten wurden Opfer der rechtsextremen Paramilitärs.
Am Höhepunkt der Gewalt in den späten 90er-Jahren sollen Todesschwadronen der rechten AUC mehr als 200 Massaker pro Jahr verübt haben. Sie ermordeten MenschenrechtsaktivistInnen, LehrerInnen und einfache DorfbewohnerInnen, die sie linker Sympathien verdächtigten. Militär und Regierung drückten dabei oft ein Auge zu. 2005 schloss der damalige Präsident Uribe Frieden mit den Paramilitärs, mehr als 20.000 Kämpfer wurden demobilisiert. Zumindest auf dem Papier. Tatsächlich schlossen sich nämlich die meisten erneut Verbrecherbanden an. „Warum sollte das jetzt anders sein?“, fragt Diberney ernüchtert, „dann nennen sie sich eben nicht mehr FARC.“ Dass sich die Geschichte wiederholen könnte, weiß auch Sonia Aguilar von UNHCR Ecuador. „Der Friedensvertrag in Kolumbien könnte dazu führen, dass manche Flüchtlinge in bestimmte Gegenden zurückkehren können, während andere wieder flüchten müssen“, fürchtet Aguilar.
Wie die historisch geringe Wahlbeteiligung von nur 37 Prozent zeigte, haben viele KolumbianerInnen den Glauben an den Frieden verloren. Auf ihrem Land lastet der Fluch von Krieg und Kokain. Klima und geographische Lage machen das Land zum idealen Anbaugebiet und Umschlagplatz für das „weiße Gold“, durch das sich sowohl Paramilitärs als auch Rebellen finanzieren. Bis 2011 versuchte die Regierung noch, die Kokapflanzen aus der Luft mit Pestiziden zu vernichten – größtenteils vergeblich. Heute ist der nördlichste Staat Südamerikas wieder der größte Kokaproduzent der Welt.
Ein ungewisser Frieden
Diberney hat Angst, Ecuador könnte ihn wegschicken, sobald in Kolumbien offiziell Frieden herrscht. Fast 90% der Flüchtlinge wollen aber gar nicht mehr zurück. Zu groß ist die Angst vor der Gewalt, zu frisch die Wunden. Fabian Rivera, der 26-jährige Kellner, stellt trotz allem klar: „Hier haben wir das Wichtigste: den Frieden“. Rivera hält den Friedensprozess im Unterschied zu vielen anderen Flüchtlingen für eine „große Chance“. Auch Deyvid Alviras, 24, sieht sich eher in der Mitte zwischen Sí- und No-Lager. Alviras will zwar, „dass der Krieg endlich aufhört“, mit den Sonderprivilegien für die FARC-TerroristInnen ist er aber nicht einverstanden.
Jetzt soll Uribe, Expräsident und Wortführer der No-Kampagne, dem frischgekürten Friedensnobelpreisträger Santos dabei helfen, einen besseren Deal auszuhandeln. Nach der Wahl gab sich der konservative Hardliner versöhnlich. „Die KolumbianerInnen, die für Ja gestimmt haben und die für Nein gestimmt haben, haben eines gemeinsam: alle wollen den Frieden.“ Es fragt sich nur, welche Zugeständnisse das kolumbianische Volk für diesen Frieden zu machen bereit ist und wie lange die Geduld der FARC noch währen wird. Während die marxistische Guerilla in einer offiziellen Reaktion ihren Willen zum Frieden bekräftigte, rief ein FARC-Kommandeur alle Einheiten auf, ihre Posten zu beziehen. Die Verhandlungen der nächsten Wochen und Monaten werden zu einem Wettlauf gegen die Zeit und gegen die tragische Geschichte des kriegsgeplagten Landes.
Auch Diberney wünscht sich den Frieden, einen gerechten und dauernden Frieden. Schon seit Jahren wartet er darauf, seine in Kolumbien verbliebenen Eltern endlich wiedersehen zu können. Vorerst wird er weiter warten müssen.